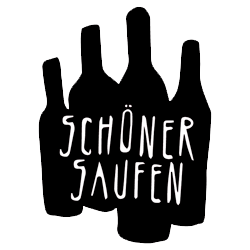China: Das Land des Becherns
Fotos: Jörg Wilczek
Dass viele Menschen mit asiatischen Wurzeln keinen Alkohol vertragen, ist mehr als ein böses Vorurteil. Es liegt an den Aldehyd-Dehydrogenasen, Enzymen, die man zum Alkoholabbau braucht und die im Stoffwechsel der meisten Ostasiaten nicht gebildet werden. Die Armen! Wir Europäer besitzen diese Enzyme vermutlich, weil wir im Mittelalter statt Dreckwasser Alkohol tranken, während die Asiaten schon damals Tee aus abgekochtem Wasser genossen. Dass abgekochtes Wasser vor Krankheiten wie Typhus und Cholera schützt, hatten wir im Mittelalter halt vergessen – vielleicht ja wegen des vielen Alkohols –, dafür haben wir eine alte Weinkultur. Einfach gesagt. Die Weinkultur in asiatischen Ländern ist jung und in vielen Regionen wird kein Wein getrunken. Dennoch, es gibt sie und der Konsum wächst rasant. Gerade China geriet schon vor einigen Jahren in die Schlagzeilen mit seinem grossen Durst nach exklusiven, teuren Weinen, besonders aus Bordeaux.
Vor ein paar Wochen wurde Schöner Saufen zur Weinkonferenz „Must – fermenting ideas“ in Portugal eingeladen, wo Menschen aus der Weinszene für Menschen aus der Weinszene sprachen. Ein Branchentreffen quasi. Gleich zwei Vorträge widmeten sich dem chinesischen Weinmarkt. Und da gab es eine Menge Neues zu hören.
Auf ex mit dem Chef
Huiqin Ma ist Weinprofessorin an der „China Agricultural University“ in Peking. Sie erklärte bei der Konferenz, warum wir Europäer nicht von unseren Trinkgewohnheiten ausgehen dürfen, wenn wir verstehen wollen, warum Chinas Weinkonsum so rasant wächst. Chinas Weinmotor: Gam-Bei, ein Trinkritual, das vor allem bei Geschäftsessen zum Einsatz kommt und quasi das Gegenteil von Schöner Saufen ist. Denn bei Gam-Bei wird auf ex getrunken. Im Idealfall sitzt der Chef noch als Letzter am Tisch und unterstreicht damit seinen Status als Chef.
"Die meisten Chinesen sind also Effekttrinker. Und so ist es nur logisch, dass es eben nicht die teuren Bordeaux-Weine sind, die den Hauptkonsum Chinas ausmachen, sondern günstige Weine aus aller Welt, vor allem aus Australien."
Gam-Bei ist ausserdem eine effektive Methode, um sich besser kennenzulernen. „Wir Chinesen sind eher verschlossen, zeigen nicht viele Emotionen“, erklärte Huiqin Ma in ihrem Vortrag. „Bei einem Geschäftsessen ist es also gut, wenn man schnell betrunken ist, dann wird alles gleich entspannter.“ Aha! Die meisten Chinesen sind also Effekttrinker. Und so ist es nur logisch, dass es eben nicht die teuren Bordeaux-Weine sind, die den Hauptkonsum Chinas ausmachen, sondern günstige Weine aus aller Welt, vor allem aus Australien.
Nach den USA, Frankreich, Italien und Deutschland steht China derzeit an fünfter Stelle, was den quantitativen Weinkonsum betrifft. Rechnet man allerdings den Pro-Kopf-Verbrauch aus, dann sieht das ganz anders aus: Durchschnittlich trinkt ein Chinese gerade mal 1.16 Liter Wein pro Kopf und Jahr – in der Schweiz sind es 37, in Deutschland immerhin 25 Liter.
China – grosses Weinland
Der grosse Teil des in China konsumierten Weins wird natürlich importiert, doch – und jetzt kommt das wirklich Interessante an dieser Geschichte – immer mehr Wein wird auch in China produziert. Die aktuellsten Statistiken dazu stammen aus dem Jahr 2015, und da lag China im weltweiten Ländervergleich in Litern auf Platz 9 – gleich vor Deutschland und Portugal.
Den zweiten Vortrag zu Chinas Weinmarkt hielt Stephen Li, ein chinesischer Ausbilder der renommierten englischen Organisation WSET, die auch die Masters of Wine ausbildet. Li erklärte zum Beispiel, warum die Chinesen fast ausschliesslich Rotwein trinken: Das hat nämlich nichts mit persönlichen Vorlieben zu tun, sondern ganz einfach damit, dass ein Wort für Weisswein im Chinesischen nicht wirklich existiert.
Dementsprechend sind auch 80 Prozent der Rebflächen mit roten Trauben bepflanzt. Und das, obwohl es in dem grossen Land eigentlich ganz viele klimatisch milde Landstriche gibt, die durchaus für die Weissweinproduktion taugen würden.
Goldrausch für den Weinrausch
Was in Chinas Weingegenden gerade passiert, sieht man am besten an der aufstrebenden Region Ningxia. Wie es sich für China gehört, wird der Weinbau hier nicht etwa vorsichtig angegangen, sondern der Staat sorgt gleich dafür, dass es gross wird, so richtig gross. Planwirtschaft halt. Bis jetzt gibt es in der Region im Nordwesten Chinas rund 40’500 Hektar Reben, die lokale Regierung will bis 2020 auf mehr als 45’000 Hektar kommen – das ist rund die dreifache Rebfläche der Schweiz oder etwas weniger als die Hälfte ganz Deutschlands. Heute gibt es rund 100 Weingüter, weitere 100 befinden sich im Bau und weil weite Teile Ningxias einer Wüste gleichen, befinden sich die Reben unmittelbar am Gelben Fluss, der als Wasserreservoir für die Pflanzungen dient. Natürlich braucht es dafür Wissen, und wer auf dieser Welt ist besser im forcierten Know-how-Transfer als die Chinesen? Schon als Dominik um die Jahrtausendwende seine Ausbildung zum Weinküfer in Franken absolvierte, hatte er einen chinesischen Klassenkameraden, gesandt vom chinesischen Staat, um später ein grosses Weingut im Land des Lächelns aufzubauen.
Das Publikum bei der Konferenz in Portugal staunte nicht schlecht, als die beiden chinesischen Redner über das Ausmass des Weinbaus berichteten. Weinprofessorin Huiqin Ma relativierte die Zahlen allerdings, denn ein grosser Teil der chinesischen Rebflächen wird für die Produktion von Speisetrauben verwendet. Zudem sei es so, dass viele chinesische Weine mit ausländischen Tropfen vermischt abgefüllt würden und es sei schwierig, überhaupt genaue Zahlen zu eruieren.
Fake Wine fürs Volk!
Da hat Huiqin Ma wohl auch einige Dinge schöngeredet. Es ist bekannt, dass China grosse Probleme mit Weinfälschungen hat. Experten sagen, dass um 2010 wohl jede zweite Flasche in den Regalen der chinesischen Weinläden in irgendeiner Art nicht ganz koscher war. Grosse Erzeuger in Europa kämpfen gegen die Fälschungen an. Und wiederum könnte man annehmen, dass es sich dabei nur um erstklassige Tropfen handeln würde. Weit gefehlt! Schliesslich wird bei Kleidern auch nicht nur Armani gefälscht, sondern eben auch Adidas. Entsprechend findet man in China auch gefälschte Supermarktweine, selbst wenn der Staat versucht, den Handel damit einzudämmen. Ein ewiger Kampf.
Doch wie schmecken sie denn, die echten chinesischen Weine? Einige davon werden sogar nach Europa exportiert, und so haben wir uns in Zürich eine Flasche besorgt. Gekauft haben wir einen Cabernet Sauvignon 2010 vom chinesisch-österreichischen Weingut Château Changyu Moser XV. Dies ist ein Joint Venture des österreichischen Weinmachers Lenz Moser mit Chinas ältestem Weingut Changyu, die Weine gedeihen in der oben erwähnten Region Ningxia.
Der Cabernet Sauvignon tut zwar mit seiner Cassis- und Holzaromatik und dem überraschend eleganten Gaumeneindruck niemandem weh, doch für 35 Franken hätten wir den einen oder anderen Tipp bereit, der weniger weit gereist ist.