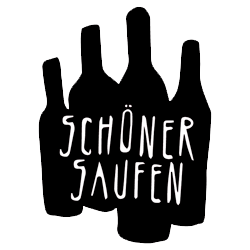Schöner Saufen im Libanon Teil IV: Suche nach Sehnsucht
Fotos: Jörg Wilczek
Wer ist dieses kleine Land und welcher Wein Libanons ureigener? Wenn wir uns am Anfang unserer Reise verirrt haben, müssen wir nun erkennen, dass dies nicht ohne Grund geschah. Aus Verirrung wurde Verwirrung. Der Inbegriff eines soliden Rausches. Kein schlechtes Ende.
Der Esel des Hirtenjungen.
Topographisch betrachtet ist der Libanon ein 225 Kilometer langer Küstenstreifen, dessen durchschnittliche Breite nicht mehr als 62 Kilometer beträgt und sich an manchen Stellen über 3000 Meter in die Höhe schraubt. Was einerseits winzig erscheinen mag, kommt uns andererseits gigantisch groß vor und ist mit solch natürlichem und kulturellem Reichtum beschenkt, dass wir aus dem Staunen bald nicht mehr herauskommen. In manchen Frühjahren kann man morgens auf dem Schnee der Libanongebirge und nachmittags auf dem Wasser des Mittelmeers Ski fahren. Was die Landschaft so gewaltig erscheinen lässt, sind ihre Berge, auf denen man sich quasi ständig bewegt. An der Küste steigt von Norden nach Süden bald das Libanongebirge empor, während sich das des Anti-Libanon von Nordosten nach Südwesten erstreckt. Das Wörtchen «Anti» drückt übrigens nichts Negatives aus, sondern versteht sich als «gegenüberliegend». Die benachbarten Berge schützen das Land vor dem Steppenklima Syriens und dem salzig-feuchten Einfluss des Mittelmeers. Ihnen verdankt der Libanon seine Fruchtbarkeit, auch seinen Wein. Nach Süden oder Norden geht es über den Coastal Highway, während der Damascus Highway die Ost-West-Schiene beschickt. Auf der geht es Richtung Bekaa-Ebene. Mitten hindurch Libanons Gemüse- und Obstkammer schlägt sich eine bestens asphaltierte Straße durch das üppige Kulturland. Auf durchschnittlich 1000 Höhenmetern wachsen hier Wein, Melonen, Oliven, Gurken, Erbsen, Zwiebeln. Eigentlich alles. Und natürlich auch Cannabis, dessen Anbau noch illegal ist. Denn der Rote Libanese genießt nicht nur bei den Connaisseurs des gepflegten Rausches einen exzellenten Ruf, sondern gewinnt auch in der Schmerztherapie zunehmend an Bedeutung. In Wein und Cannabis lege die Zukunft, daran glauben jene Libanesen, die es wissen müssen, weil sie beides in hoher Güte probiert haben. Legale Viktualien indes bieten Händler im Verlauf der gesamten Hochebene feil. Kürbisse, Melonen oder Kartoffeln sind kunstvoll aufgetürmt oder stehen in losen Säcken an den Straßenrändern, wo alte Nippon-Lastwagen mit ausgeschlachteten Innenräumen und handbemalten Karosserien parken. Liebesschwüre in kunstvoll geschwungenen Schriftformen und Zedernbäume in detailreich geschmückten Bildern bleiben auf unabsehbare Zeit die Nummer Eins bei den Verzierungen der patriotisch aufgeladenen Brummis. Andernorts für schrottreif befunden, geben sich unzählige Lieferwagen aus deutschen Landen eher pragmatisch, wenn sie von Türen und Heckscheiben als «Rolf-Wagner-Elektroanlagen» oder «Maler Spindel» ihre ehemaligen Besitzer aus der Ferne grüßen.
Melonen und Kürbisse am Strassenrand im Bekaa Valley.
Vorne Benz und hinten Ford
Es hat sich ein reger Handel mit Ersatzteilen entwickelt, aus denen mitunter abenteuerliche Fahrgeschäfte zusammengeschweißt werden: vorne Benz und hinten Ford. Auf den Höfen der Werkstätten türmen sich Kühlerhauben, Kotflügel und Türen jeglicher Couleur. Die Elite setzt auf SUVs mit verdunkelten Scheiben. Da der öffentliche Nahverkehr mehr Sport ist, als dass er einen zuverlässigen Transport von A nach B gewährleistet, gibt es im Libanon keine ernsthafte Alternative zum Auto. Das einst gut ausgebaute Schienennetz ist nach dem Bürgerkrieg nie instandgesetzt worden. Hie und da tauchen seine Reste als ein paar Meter Gleise aus dem Berggeröll auf und ziehen rostrote Fäden über kalkweißen Grund. Wer den Highway verlässt, muss sich auf eine schlechte Piste einstellen. Mehr oder weniger löchriger Asphalt wird zum ordentlichen Standard. Manchmal kann der Weg unversehens in unpassierbarem Morast enden oder an einer unüberwindbaren Steigung im Gebirge scheitern. Im Winter sind viele Orte von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Die Ausfahrt vom Highway ist nicht selten der Anfang eines Abenteuers.
Chateau Qanafar
«Eine Zeitlang war das ein nettes Hobby»
Wir folgen einem schmalen Schotterweg, der uns über granattrichtergroße Löcher steil bergauf führt. Ein grüner Land Rover kommt uns entgegen. Die Straße ist zu schmal, um aneinander vorbei zu rangieren. Es sind Eddy Naim und sein Vater Georges. Wir sollen unser Auto hier stehen lassen, sagen sie. «Mindblowing» sei ihr Weingut Château Qanafar, erzählte uns gestern jemand im Hotel. Der Name geht auf den Heimatort der Familie Naim zurück. In Khirbat Qanafar begann George nach seiner Pensionierung als Chemiker vor rund 20 Jahren mit dem Weinmachen. In seiner Garage, mit Trauben von nicht einmal einem Hektar Land. «Eine Zeitlang war das ein nettes Hobby», sagt Georges und lächelt sanft: «Als aus einem Hektar immer mehr wurden, reichte eine Garage bald nicht mehr aus. Es wurden immer mehr.» Im ganzen Ort seien die schließlich verteilt gewesen. Allein habe er das irgendwann nicht mehr bewerkstelligen können. Und jünger werde er auch nicht, sagt er fast ein bisschen kokett. 2010 stieß sein Sohn Eddy dazu, der sich sein theoretisches Weinwissen bei einem Fernstudium an der Universität Davis in Kalifornien aneignete. Vater und Sohn ließen die Garagen hinter sich und bauten Château Qanafar.
Aussicht vom grossen Tasting Room auf Chateau Qanafar.
Wir machen uns keine Vorstellung
Wir sehen den Komplex bereits aus einiger Entfernung, wo er als riesige Betonhülle über der Bekaa-Ebene thront. «Der Keller ist schon seit ein paar Jahren in Betrieb», sagt Eddy, während er den Geländewagen nonchalant eine Schotterpiste hinaufsteuert, die selbst routinierten Alpinisten einiges abverlangen dürfte. Hinter den Betonrahmen sollen einmal Verkostungsraum und Panorama-Restaurant entstehen. Weil schon die Phönizier einen exzellenten Ruf als Glashersteller besaßen, machen wir uns um eine gelungene Ausführung der gewiss gigantischen Panoramafenster keine Sorgen, doch Maschinen und Material hier hinaufzuschaffen, scheint uns ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Als hätte Eddy unsere Gedanken gelesen, sagt er: «Wir haben es bis hierhin geschafft, da werden wir den Rest auch noch schaffen.» Stück für Stück heraufgefahren seien die Elemente worden, lange habe das gedauert. Sehr lange, sagt Eddy. Wir machen uns keine Vorstellung. Der 39-Jährige ist von bäriger Statur. Gleichmut und Gutmütigkeit muss er gleichermaßen für sich gepachtet haben. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach dieser Ort, seine Heimat, der Wein, die ihn dieses gemütliche Gottvertrauen ausstrahlen lassen. Château Qanafar bietet eine atemberaubende Aussicht. Es bleibt weiter erstaunlich, dass es der kleine Libanon in manchen Bereichen nicht unter Superlativen macht. Das rohe Gebäude sieht aus wie eine Mischung aus Parkhaus und Guggenheim-Museum. In seinem kathedralartigen Inneren schraubt sich eine schneckenförmige Straße in einen Keller, der sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat.
Degustation auf Chateau Qanafar.
2017 hat sich Eddy an einem Riesling versucht
17 Hektar Kalk mit lehmigem Untergrund breitet sich als arrondierte Ebene direkt unterhalb des Weinguts aus. Das Terroir sei ideal, meint Eddy. Der Lehm halte die Feuchtigkeit, während der Kalk für ausreichend Drainage bei heftigen Niederschlägen sorge. Die fallen im Libanon meistens ausreichend in den Wintermonaten. Trotzdem muss der Ertrag grundsätzlich niedrig ausfallen, wenn die jährliche Produktion von Château Qanafar selten 50.000 Flaschen übersteigt. 2017 hat sich Eddy an einem Riesling versucht. Der erste reinsortige Wein des Weinguts ist ihm gut gelungen, bringt neben aparter Frische auch würzige Attribute an den Gaumen. Bei seinen Cuvées gibt sich Eddy experimentierfreudig. Die Zusammenstellung der Traubensorten lege der Jahrgang fest, sagt er. Ist der Hauptanteil bei seinem Top-Rotwein «Château Qanafar» 2013 Syrah, geben etwa im Jahrgang 2009 Cabernet Sauvignon und Merlot den Ton an. Das führt einerseits zu ganz unterschiedlichen Stilen seines Château-Weins und macht eine allgemeine Einschätzung schwierig, zeigt andererseits aber auch, wie unterschiedlich die Jahre auf rund 1200 Höhenmetern ausfallen können. Der 2009er hat bereits ein seriöses Depot angesammelt, während sein Geschmack gerade juvenil aufblüht. Exzellenter Stoff, dem eine mutmaßlich große Zukunft bevorsteht.
Teilansicht der Reben von Chateau Qanafar.
Viele Libanesen fremdeln mit einer arabischen Identität
Dass der Libanon das einzige Land in der arabischen Welt ist, in dem der Weinbau bis heute eine große wirtschaftliche und kulturelle Rolle spielt, hat auch damit zu tun, dass nirgendwo im Nahen Osten mehr Christen leben. Über 50 Prozent sollen es sein. Genau weiß das aber niemand. Die letzte Volkszählung fand vor über 86 Jahren statt. Weil die Region heute untrennbar mit dem Islam verbunden ist, fremdeln viele Libanesen mit einer arabischen Identität. Das Bewusstsein Libanons sei maßgeblich französisch geprägt, sagen die einen, während die anderen ihre Kultur bis zu den Phöniziern zurückverfolgen, die 3000 v. Chr. das «gelobte Land» Kanaan besiedelten, zu dem auch der Libanon gehörte. Der Weinbau geht auf das semitische Volk zurück, ist vermutlich aber noch viel älter. Während Wein in Arabien als Elixier galt, wurde er in der Zeit des Osmanischen Reiches in vielen Bereichen immerhin geduldet. Was ihm nachhaltig schadete, war der Bürgerkrieg. Über 15 Jahre dauerte das Morden von Christen und Muslimen, dessen Sinn sich am Ende niemandem mehr ernsthaft erschließen wollte und 100.000 Menschenleben forderte. Chateau Musar trotzte diesem Irrsinn und wurde auch darüber zur Legende. Doch nicht nur das. Musar und seine Geschichte sind womöglich wertvolle Puzzleteile zum Verständnis der libanesischen Wein-Identität. Der Franzose Gaston Hochar bewies gewieften Geschäftssinn, als er 1930 seine Karriere als Weinmacher im Libanon begann.
Blick hinunter in das Bekaa Valley.
Mit der Unabhängigkeit 1943 wurden die Entfernungen nicht kürzer, mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 1975 aber deutlich beschwerlicher
Das Land stand zu dieser Zeit unter dem Mandat Frankreichs – und seinem Militär, dessen hohen Ränge guten Wein zu schätzen wussten, an den zu gelangen aber fast unmöglich war. Mit der Gründung von Chateau Musar schloss Hochar diese Lücke und wurde zum Wein-Caterer der vinophilen Franzosen im Libanon. Seine Weine verkaufte er nicht etwa in Fässern, wie es damals auch in Frankreich noch üblich war, sondern füllte sie als Chateau Musar von Anfang an auf Flaschen ab. Für sein Weingut wählte Hochar einen Ort auf rund 1000 Höhemetern in christlichem Gebiet, ungefähr 30 Kilometer nördlich von Beirut in der Ortschaft Ghazir. Hochars Weinberge indes lagen im Bekaa, rund 80 Kilometer vom Weingut entfernt. Mit der Unabhängigkeit Libanons wurden die Entfernungen dorthin nicht kürzer, mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 1975 aber deutlich beschwerlicher. 1976 blies das Weingut die gesamte Ernte wegen einer angekündigten Blockade in der Bekaa-Ebene ab. Die Blockade kam. Es sollte das einzige Jahr während des Bürgerkriegs ohne einen Chateau Musar bleiben. Bis zum heutigen Tage werden die Trauben von Bekaa in offenen Trucks bis zum Weingut gefahren. «Die Oxidation nehmen wir dabei gerne in Kauf», sagt Gaston Hochar, der heute gemeinsam mit seinem Bruder Marc die Geschäfte von Chateau Musar führt. Für einen studierten Ingenieur spielt er bei seinen Ausführungen ungewöhnlich viel mit Suggestion. Musars Rotweine sind berühmt und berüchtigt. Nicht nur, weil sie ein unglaubliches Reifepotenzial, sondern auch einen ganz eigenen Geschmack besitzen, den zu beschreiben eigentlich eine Unmöglichkeit ist.
Gaston Hochar von Chateau Musar.
Immer ist da ein Wein, dessen Herkunft über seinen Varietäten zu stehen scheint
Seit seinen Anfängen besteht ein roter Chateau Musar aus Cabernet Sauvignon, Cinsault und Carignan und ist dennoch stets ein Wein, der seine Rebsorten niemals so widerspiegelt, wie man es gemeinhin erwarten würde. Nie ist er üppig, zu reif oder zu vollmundig, seine Säure nie ohne Belang oder seine Tannine zu grün. Immer ist da ein Wein, dessen Herkunft über seinen Varietäten zu stehen scheint. Keine «Alte» und keine «Neue», eine «Musar-Welt». Dabei spielen viele Dinge zusammen. Der robuste Transport der Trauben hat damit ebenso zu tun, wie der Fasskeller, in dem die Luftfeuchtigkeit an diesem heißen Augusttag fast 90 Prozent betragen muss. Auf über 1000 Metern von einem Keller zu sprechen, muss ohnehin relativ bleiben. Wir schwitzen salziges Wasser zwischen übereinander getürmten Barriquefässern, von denen keines jünger als zwei Jahre ist. «Neue Fässer werden lediglich zum Weingrün-machen genutzt», sagt Hochar und schwitzt überhaupt nicht. Adaption nennt man das wohl.
Gärtanks aus Beton auf Chateau Musar.
Weinmachen bedeutet auch den Wein machen zu lassen
Der Mann ist ebenso von sich überzeugt wie höflich und sympathisch. Jeder Wein reift reinsortig zwei Jahre in gebrauchten Barriques, bevor sich die fertige Cuvée weitere zwölf Monate in Betontanks verfeinern darf. «Wir haben es auch schon mit Edelstahl versucht, doch das Ergebnis war nicht dasselbe», sagt Hochar. Weinmachen bedeute auch, den Wein machen zu lassen. Und Beton stehe einem Musar eben besser zu Gesicht als Edelstahl. Nach vier Jahren auf der Flasche wird der Wein zum Verkauf freigegeben. Tatsächlich findet sich auf Chateau Musar keine Spur vinologischer Hochtechnologie, vielmehr scheint die Zeit seit seiner Gründung fast stehengeblieben zu sein. Doch ganz anders als beim Hotel Château Bernina vom Beginn unserer Reise hat sie sich hier nicht vergessen, sondern ist in mystischer Art sehr lebendig, in den Katakomben bis zu seinen Anfängen als Wein konserviert. Hochar lässt einen roten 1971er Musar aus einer halben Flasche öffnen. Natürlich ist der Wein reif, aber er besitzt einen so lebendigen Kern, dass es uns die Nackenhaare kräuselt.
Barrique Keller, Chateau Musar
«Musar ist lebendig»
Wie labil dieser Eindruck ist, beweist uns Hochar, als wir denselben Wein noch einmal probieren sollen. Natürlich reproduziert sich der Eindruck aus dem Keller nicht. Gleichwohl ist der Wein noch immer exzellent. «Musar ist lebendig», sagt Hochar in einem ebenso lapidaren wie lyrischen Ton. Er hat den Mythos begriffen – und formuliert ihn sehr leise und mit Bedacht. Wir hören ihm sehr gut dabei zu. Auf die Frage, ob er mehr Libanese als Franzose sei, antwortet Hochar, dass er seit der Hochzeit mit einer Schweizerin einen Pass der Eidgenossen besitze. Wie es um libanesische Rebsorten bestellt sei, wollen wir wissen. Hochar zuckt mit den Schultern: «Bei unserem weißen Chateau Musar arbeiten wir ausschließlich mit den heimischen Sorten Obaideh und Merwah.» Das allerdings seien Varietäten, die nur im Gebirge zu jener Reife gelangen, um sie zu gutem Wein werden zu lassen. Der Weinbau ist während des Bürgerkriegs in der Bekaa-Ebene fast, im Gebirge vollständig zum Erliegen gekommen. Jetzt erholt er sich auch in den Höhenlagen langsam wieder. Und damit auch seine autochthonen Sorten, bei denen rote keine Rolle spielen.
Es braucht nicht viele Vokabeln, um eine Delikatesse zu beschreiben
Gaston Hochar von Chateau Musar.
«Um die Säure zu halten, brauchen wir die Höhe», sagt Hochar, «Obaideh und Merwah wachsen bei uns auf bis zu 1500 Metern.» Beim 2009er notieren wir «Frische», «Honig» und «Entzückung». Es braucht nicht viele Vokabeln, um eine Delikatesse zu beschreiben. Meistens ist es sogar umgekehrt. Der Libanon zählt zu den ältesten weinbauproduzierenden Ländern der Welt. Doch sein Fingerabdruck scheint fortwährend zu verschwimmen. Wer ist dieses kleine Land und welcher Wein sein ureigener? Im Libanon scheint Bekaa eine Konstante zu sein. In Baalbek, unweit der fruchtbaren Ebene, begannen die Römer 15 v. Chr. eine gigantische Tempelanlage zu errichten, deren Arbeiten bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. andauern sollten. Dass der Wein eine zentrale Rolle zu dieser Zeit spielte, lässt sich noch heute bestaunen: Der Bacchus-Tempel gehört zu den größten und besterhaltenen Heiligtümern der Römischen Epoche weltweit. Welcher Art Wein die Römer und noch weit früher die Phönizier kelterten, ist nicht überliefert. Libanons Weinbau-Biographie hat ebenso viele Brüche wie die seines Volkes. Fünfmal am Tag tönen die Salǡh heute über das weitläufige Tempel-Gelände. Baalbeks Bevölkerung ist zum größten Teil muslimisch. Dass die schiitische Hisbollah hier nicht nur das Sagen, sondern auch ihre Merch-Zentrale hat, merken wir recht schnell, als uns alle paar Meter Händler T-Shirts, Flaggen und Kappen mit der emporgestreckten Kalaschnikow im Logo verkaufen wollen. Kaffeetassen mit dem Abbild ihres Generalsekretärs gibt es freilich auch. Hassan Nasrallah ist in Baalbek allgegenwärtig. Beim Fotografieren sollen wir uns zurückhalten, rät man uns.
Bacchus Tempel in Balbeek.
Um den Wetterunbilden zu entgehen, weichen mittlerweile fast alle weinbautreibenden Länder auf ihre Höhenlagen aus
Und so ist es wieder ein Paradoxon, das den Libanon prägt, ihn eins in seiner Uneinigkeit macht, wenn an jenen Stätten, die Libanons Weinkultur einst mitbegründeten, der Wein heute keine Rolle mehr spielt, sein größtes Anbaugebiet aber genau hier liegt: in der fruchtbaren Bekaa-Ebene. Ob sie das bleiben wird, wird sich noch zeigen. Denn zweifellos ist das Klima auch im Libanon in den letzten Jahren extremer geworden, was die Bekaa-Ebene immer häufiger als viel zu lang andauernde Hitzewellen oder schweren Unwettern zu spüren bekommt. Um den Wetterunbilden zu entgehen, weichen mittlerweile fast alle weinbautreibenden Länder auf ihre Höhenlagen aus. Sofern sie denn welche besitzen. Der Libanon hat derer reichlich. Viele von ihnen sind nach dem Bürgerkrieg nie rekultiviert worden, auch weil der Weinbau im Gebirge weitaus beschwerlicher als in der agrarindustriellen Bekaa-Region ist. Vollernter wird man dort trotzdem nicht finden, weil Beduinen als Erntehelfer weitaus günstiger zu haben sind. Vom Bild, dass ihre Stämme einem extravaganten Leben à la «Lawrence von Arabien» frönen, darf man sich getrost verabschieden. Aus stolzen Nomaden sind arme Menschen, aus ihren prachtvollen Zelten elendige Slums am Rande der Gesellschaft geworden. Auch das ist der Libanon.
Bacchus Tempel in Balbeek.
Es ist von Monaco und Hollywood ein bisschen
Der Ort Batrun, im Norden Libanons, strahlt eine fast künstliche Schönheit aus. Es ist ein bisschen Monaco und ein bisschen Hollywood, als wir die Serpentinen zu unserem nächsten Ziel «Ixsir» hinauffahren. Ein weiteres, nicht gerade bescheidenes Projekt, das 2006 gegründet wurde. Der US-amerikanische Fernsehsender CNN nahm das Weingut vor einigen Jahren als eines der weltweit «grünsten» Gebäude in seiner Architekturliste auf. Mit seiner dicken Hülle aus massiven Kalksteinen erweckt das Weingut einen historischen Eindruck. Sein Inneres ist eine moderne Wein-Erlebnis-Welt, in der wir uns schnell fragen, wo dessen Namensgeber, das Elixier, wohl verborgen liegen mag. Der «Ixsir Grand Reserve Rosé» sieht dem Miraval von Brad Pitt und seiner Ex Frau Angelina Jolie nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern schmeckt auch so. Dabei erinnert «Ixsir» nur ab und zu an ein Wein-Walt-Disney, weil auf seiner weitläufigen Terrasse (bester Blick ist hier, wie fast überall im Libanon, obligatorisch) authentische libanesische Küche serviert wird. In den Weinen finden wir das Land nicht wieder. Aber können wir das überhaupt, ist unsere Suche am Ende nicht immer auch von einem frommen Wunsch geprägt, von einer wildromantischen Idee, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat? Die Terrasse von «Ixsir» ist gut besucht. Augenscheinlich von Menschen, die es sich leisten können. Bei vielen liegt der libanesische «Whispering Angel» auf Eis.
Ixir Winery.
Aus Verirrung wurde Verwirrung
Es sind jene Gegensätze, die uns dieses Land immer wieder aufs Neue auftischt. Zu schnell sind die Intervalle, zu schnell scheint an einer Stelle etwas zu vergehen, bevor es an einer anderen wieder aufblüht. Wir staunen und verstehen mit jedem zurückgelegtem Kilometer mal mehr und mal weniger. Meistens vermutlich gar nichts. Ein Land, das viermal in die Schweiz passt, verändert sich fortwährend vor unseren Augen, ist kaum begreifbar, obwohl es doch greifbarer kaum zugehen könnte. Wenn wir uns am Anfang unserer Reise verirrt haben, müssen wir nun erkennen, dass das nicht ohne Grund geschah. Aus Verirrung wurde Verwirrung. Der Inbegriff eines soliden Rausches. Der Libanon ist eine bipolare Schönheit. Die Weinnaturalisten wünschen sich das ja immer, dieses großartige Fest, wo sich Mensch und Natur als wilde Köstlichkeit zusammenfinden, reiner Wein eingeschenkt wird, der Anfang von allem ist, des Pudels Kern. Die große Show der Wein-Volksmusikanten. Eine Welt, die es realiter nicht gibt. Eine Lüge unserer Vorstellung. Wir glauben gerne an sie. Und manchmal dürfen wir von ihr kosten. So köstlich, dass wir zu unserem Glauben kommen.
Vertical 33
Es wird, da sind wir uns sicher, die neue Art eine Geschichte zu verfilmen
Am Ende dieser Reise geben wir unser Ehrenwort, dass das beste Omelett auf mindestens 1400 Metern irgendwo in den Libanongebirgen zubereitet wird. Sein Meister heißt Eid Azar. Er bedient unsere Erwartungen an ein wildromantisches Libanon auf köstlichste Art und Weise, stellt eine dünne Pfanne auf den Rost eines gemauerten Holzkohlegrills, gibt Ei und Lamm-Fett hinein und schaut mit einem Gesicht in die Ferne, darüber wir zu Steven Spielberg werden, den Blockbuster nicht nur vor Augen, sondern auch am Gaumen. Es wird, da sind wir uns sicher, die neue Art eine Geschichte zu verfilmen. Wir werden Hollywood revolutionieren, weil die gemeinsame Geschichte von George Cortas, Eid Azar und Joseph Gnossein nur so weit erzählt wird, um eins mit ihrer Landschaft zu bleiben, mit dem Geschmack, den wir uns ihn kreieren. Kein Wort über jene Zeit in den Staaten, als sie Karriere machten, sich beim Genuss edelster Burgunder kennenlernten und erste Pläne für ein Weingut in ihrer Heimat schmiedeten. Was zählt ist der würzige, ja fast süße Geschmack eines Omeletts vom Holzofengrill. Und dieser Wein, der natürlich ein reinsortiger Obaideh ist und zu diesem Gericht kein besserer sein könnte. Weil er traumhaft schmeckt, ist jedes Wort über ihn umsonst. Das Weingut heißt «Vertical 33». Die drei Freunde haben hier Großes vor. Sie werden aufhorchen lassen. Die Luft ist von einem ätherischen Duft geschwängert, der an harzige Cannabis-Blüten erinnert. Tatsächlich wird er von «Tayoun» verdunstet. In kleinen und großen Teppichen rollt sich das Kraut über die Landschaft aus. Man braucht nicht nach ihm zu suchen. Sein Duft findet jeden. Es ist der Rausch.
Blick hinunter von Vertical 33 auf den Damaskus Highway, welches noch 35 Kilometer entfernt liegt.
Die Libanon-Reise von Schöner Saufen wurde organisiert und finanziert von Nico Grandjean und libanesischen Winzern. Ausgewählte libanesische Weine sind bei Grandjean Trading erhältlich. Herzlichen Dank.