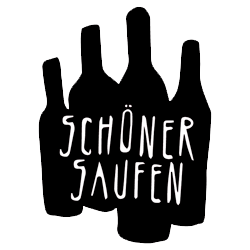In der Welt die es nicht gibt
Fotos: Jörg Wilczek
Hans-Peter Schmidt setzt auf bewussten Kontrollverlust. Einen Zustand, den nicht nur Winzer fürchten, sondern das Gros der gesamten Menschheit. Schmidt wirkt seit etwa zehn Jahren auf der Domaine Mythopia im schweizerischen Wallis, einem Ort, der anders ist. Als wir ihn im Spätsommer des letzten Jahres kurz vor der Ernte in Arbaz besuchen, fährt er mit uns zu seinen Rebparzellen, weit oben über dem Tal. Vor uns liegt ein bräunlich-grüner Dschungel. Die hüfthohe Begrünung mit Rebstöcken, einigen Obstbäumen und Sträuchern dazwischen erscheint unwirklich. „Das hier ist vermutlich der einzige Weinberg auf der Welt, der nicht gespritzt wird und trotzdem eine Ernte einfährt“, sagt Schmidt und schmunzelt.Die Trauben an den Rebstöcken sind nicht ganz gesund, immer wieder finden sich dazwischen vollständig eingetrocknete Beeren. Oidium, eine Pilzkrankheit, die jeden Winzer und vor allem Schmidts Walliser Kollegen mit den blank gespritzten Weinbergen in Alarmbereitschaft versetzt. Schmidt hingegen wirkt ganz ruhig, als er uns erklärt, dass er die Rebparzelle vor uns in diesem Jahr nur mit einem Fermentationsprodukt aus Rebblättern behandelt hat. Dafür vergärt er gesunde Traubenblätter im Frühling mit Zucker und Wasser unter Abschluss von Sauerstoff. Ein Verfahren, das man in ähnlicher Form von Sauerkraut und Kimchi kennt. Die Technik hat Schmidt auf seinen Reisen als landwirtschaftlicher Berater in Asien kennengelernt und übernommen. Die Landwirte dort sind so arm, dass sie sich die teuren Spritzmittel nicht leisten können. Deshalb sind sie gezwungen, sich auf althergebrachte, natürliche Methoden wie eben die Vermehrung von Mikroorganismen durch Fermentation zu beschränken. Die erhöhte Anzahl von Hefen, Bakterien und anderen Kleinstlebewesen in dem Fermentationsprodukt stärkt die Abwehrkräfte der Pflanze auf natürliche Weise. Klassische, für den Bioanbau zugelassene Fungizide wie Schwefel und Kupfer sieht Schmidt schlichtweg als Gifte an, die wichtige Bakterien und Hefen auf den Trauben töten und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. In den ersten Jahren ist der Verzicht auf Fungizide nach Schmidts Erfahrung sehr heikel, denn das System kann sich noch nicht vollständig selbst gegen die Eindringlinge wehren. „Wenn man nur zwei Zeilen in einem normal bewirtschafteten Rebberg nicht behandelt, sterben die Rebstöcke. Um in ein neues Gleichgewicht zu gelangen, muss man auf der gesamten Fläche Verzicht üben.“ Dahinter steckt letztlich die Theorie, dass es in der Natur niemals so weit kommt, dass alle Lebewesen gleichzeitig sterben. Also werden nicht alle Rebstöcke auf einmal eingehen. Hans-Peter Schmidt lässt sich ganz bewusst auf dieses unkalkulierbare Risiko ein und wartet ab, was passiert. Im letzten Jahr war die Ernte deshalb nicht besonders gross, aber er wird noch mindestens drei Jahre weitermachen, um zu sehen, ob sich sein Ökosystem Rebberg langfristig in eine Balance bewegt. Er ist ein Pragmatiker, übt auch sonst bei der Weinbergarbeit Verzicht und beschränkt sie auf ein Minimum. „Wir sind seit zehn Jahren bestrebt, im Weinberg weniger zu tun. Weniger Arbeiten, die unserer Ansicht nach unnütz sind, wie das Entblättern beispielsweise. Ich könnte jetzt sogar zwei Wochen in den Urlaub fahren und müsste mich nicht um die Reben und die Begrünung kümmern. Es reguliert sich von selbst“, erklärt er uns.
Er wird einfach gar nichts mehr tun und dann in knapp sechs Wochen ernten. Seine Sicherheit hat sich Schmidt über eine Dekade hinweg erarbeitet, er war mutig, lernte aus Fehlern. Auch im Keller. Da macht er nämlich genau das, was für andere Önologen die sofortige Kündigung bedeuten würde: rein gar nichts. Die Maische kommt ins Fass, das wird verschlossen und dann wird nichts weiter getan als gewartet. Nicht Wochen oder Monate, sondern Jahre. Auf die Frage, ob es nicht ein besonders grosser Nervenkitzel sei, den Wein einfach sich selbst zu überlassen, antwortet Schmidt, dass es am Anfang schon aufreibend sei, aber mit der Zeit wachse das Vertrauen in den bewussten Kontrollverlust. Beim Finito, einem reinsortigen Silvaner, der uns besonders gut gefällt, wartet er in der Regel ganze zwei Jahre, bevor er das Fass wieder öffnet und nachsieht, was passiert ist, ob der Wein schon so weit ist, um abgefüllt zu werden. Während des gesamten Prozesses verzichtet er auf Schwefeldioxid, das klassische Konservierungsmittel für Wein. Stabilität erhalten seine Weine durch den Einfluss von Sauerstoff. Und nach seiner Erfahrung ist der Sauerstoffaustausch durch das Holzfass dabei vollkommen ausreichend. Nach zwei Jahren im Fass können die Weine durchaus ein halbes Jahr offen in der Gegend rumstehen und es passiert nichts. Die Weine sind zu stabil, um Essig zu werden.