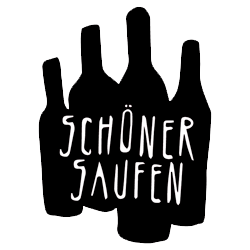Champagner geht immer...
Fotos: Jörg Wilczek
Champagner geht immer. Das ist eine der wenigen, wenn nicht die einzige Pauschalaussage in der Weinwelt, die so ziemlich stimmt. Nur: Champagner ist nicht gleich Champagner. Was die meisten nicht wissen: Es gibt viel mehr als Markenweine wie Moët & Chandon, Veuve Clicquot oder Bollinger. Die Region in Nordostfrankreich gehört zu den spannendsten Weinregionen der Welt. Wie das Burgund etwa, das Piemont oder die Mosel, mit dem einzigen Unterschied, dass die Weine in der Champagne prickeln.Alexandre Chartogne gehört zu einer neuen Generation von Champagnerproduzenten. Wir treffen ihn anlässlich eines Champagnerseminars für Gastronomen im Zürcher Popup-Restaurant Wildbar, wo seine Weine auch auf der Karte stehen. Organisiert wurde das Ganze von seinem Schweizer Importeur Cultivino. Alexandre ist 33 Jahre alt und macht Winzerchampagner, er baut also selber Trauben an und produziert Schaumwein daraus. Das ist in seiner Region eine Seltenheit: „95 Prozent unserer Anbaufläche gehören Weinbauern wie mir“, erklärt Alexandre, „97 Prozent der Weine werden aber von den grossen Häusern verkauft.“ Mit grossen Häusern meint er berühmte Champagnermarken. Es ist also logisch, dass die wenigsten Weinbauern auch selber Wein keltern, sie verkaufen ihre gesamte Traubenproduktion an die grossen Häuser, die selber meist gar keine Reben besitzen. Das lohnt sich, denn die Traubenpreise sind hier so hoch wie nirgendwo anders auf der Welt.
"Méthode" als Mittel zum Zweck
Es verwundert dann auch nicht weiter, dass in der allgemeinen Wahrnehmung die Méthode Traditionelle – die klassische Flaschengärung – als der entscheidende Schritt bei der Champagnerherstellung angesehen wird. Bei der Méthode Traditionelle oder Méthode Champenoise oder eben Flaschengärung wird dem vergorenen und gereiften Wein nochmals Zucker und Hefe beigegeben, die Mischung wird in Flaschen gefüllt, diese dicht verschlossen und so verbleibt bei der sogenannten zweiten Gärung die Kohlensäure im Wein. Was hier kurz erklärt ist, dauert oft viele Jahre – und das Warten aufs Geld, das muss man sich leisten können. Ein weiterer Grund, warum die Weinproduktion in der Champagne auch heute noch gerne den grossen Häusern überlassen wird. „Ein hochwertiger Champagner ist auch immer ein hochwertiger Wein“, erklärt Alexandre zu Beginn seines Seminars. „Und ein hochwertiger Wein kommt von guten Trauben, die auf einem guten Boden gewachsen sind.“ Die Flaschengärung ist für Alexandre nicht mehr als Mittel zum Zweck. Familie Chartogne betreibt schon seit 500 Jahren Weinbau in der Region Mérfy, wo sie auch heute noch zuhause ist. Doch die Geschichte mit dem Selbstkeltern startete vor nicht mehr als zwei Generationen. „Als ich 2006 den Betrieb übernahm, wollte ich alles anders machen“, erzählt Alexandre. Und das ist kein Wunder. Sein Mentor ist nämlich kein Geringerer als Anselme Selosse, der Urvater der Winzerchampagner-Bewegung und eigentliche Reformator der gesamten Region. Grundsätzlich gibt es in der Champagne heute zwei verschiedene Philosophien, und das ist Leuten wie Selosse zu verdanken. Auf der einen Seite gibt es die zusammengesetzten Weine oder Cuvées. Diese werden aus Weinen von Trauben aus verschiedensten Lagen und oft auch Jahrgängen zusammengestellt. „Diese Weine sind auch sehr gut“, sagt Alexandre Chartogne. Doch sein Herz schlägt für die zweite Schule. Wie sein Mentor Selosse möchte er in seinen Weinen den Ausdruck einer Lage zeigen, den Ort, an dem der Wein gewachsen ist. Das ist sein höchstes Ziel.
Verlorene Tradition
Alexandre brauchte einige Jahre, bis er realisierte, dass er seinem Ziel des bedingungslosen Ausdrucks der Herkunft nicht näher kommen würde, wenn er alles anders machte als seine Vorfahren. Familie Chartogne führt seit Jahrhunderten Buch über ihre Lagen, über die Ernten der einzelnen Jahrgänge, die Qualität und das Vorgehen. Es wäre dumm, sich das alles nicht zunutze zu machen. „Bevor ich loslegen konnte, musste ich die Geschichte meiner Region verstehen. Das Problem dabei ist, dass wir einen grossen Teil unserer ursprünglichen Tradition im Weinbau verloren haben“, sagt Alexandre und spricht damit die Rückschläge an, die die Region um 1900 erlebte. Zum einen war da die Reblaus, die zu dieser Zeit fast alle Rebstöcke Europas zerstörte, zum anderen beutelten die beiden Weltkriege die Region so richtig durch. Beim Wiederaufbau wollte man alles besser machen – zugunsten der Quantität, was nicht nur beim Wein in krassem Gegensatz zur Qualität steht. Alexandre kommt während seiner Präsentation immer wieder auf den Boden zu sprechen, etwa darauf, dass man einen Champagner an seiner Salzigkeit erkennt, die vom Kalk in den Böden herrührt. „Das sind Fischskelette aus dem Urmeer“, erklärt er. Kalk findet man in vielen guten Weinregionen, er hat die Eigenschaft, Wasser zu speichern und dieses bei Bedarf an die Rebwurzeln abzugeben. Dieses Wasser wird während seiner Zeit im Boden mineralisiert und so wird schlussendlich die Information des Bodens in der Traube eingelagert. So die einfache Version, die unter Wissenschaftlern nicht unumstritten ist. Aber aus irgendeinem Grund muss man ihn ja schmecken, den Kalkuntergrund.
Alexandre Chartogne zeichnet zwei Quadrate auf eine Flipchart, er arbeitet gern mit Zeichnungen, obwohl er von sich sagt, dass er gar nicht zeichnen könne. In das eine Quadrat zeichnet er wild Punkte für die Reben und beschriftet es mit der Zahl 30 000 für die Anzahl Reben pro Hektar. Im anderen zeichnet er die Punkte in Linien und versieht das Quadrat mit der Zahl 10 000. Die Erziehung der Reben in Reihen entstand in der Champagne erst nach der Reblauskatastrophe, und weil die Menschen arm waren und einfach etwas ernten wollten, pflanzten sie ganz einfach die Traubensorten, die sie auch benötigten. „Leider ging dabei das uralte Wissen verloren, wo eine Rebsorte besonders gut gedeiht“, sagt Alexandre. Denn dort beginnt – nicht nur für ihn – die Qualität. Der Grund für die Pflanzung in Reihen ist die einfachere Bewirtschaftung. Und die Anzahl der Reben? Dafür zeichnet Alexandre eine weitere Grafik an die Flipchart. Sie zeigt die einzelnen Rebstöcke, die früher ganz wenige Trauben trugen. Im heute verbreiteten, sogenannten Cordon-System sind es bis zu 18 Triebe und entsprechend viele Trauben, die eine einzelne Pflanze mit Nährstoffen versorgen muss. Einen Doktortitel in Rebbau braucht man nicht, um zu verstehen, dass das mit der Einlagerung der Mineralien aus dem Kalk so nicht wirklich gleich gut ablaufen kann.
Das Erbe der Vorfahren
Für Alexandre waren die Erkenntnisse, die er bei seiner Champagnerschulung in Zürich präsentiert, alles Augenöffner und davon gäbe es viele weitere. „Am Ende musste ich mir eingestehen, dass meine Vorfahren wohl schon nicht so vieles falsch gemacht haben“, sagt er. 2006, bei seiner Übernahme, gab er zuerst die Herbizide und Pestizide auf, kaufte Kühe und Pferde und begann so zurückhaltend wie nur möglich im Rebberg zu arbeiten. Heute gibt es dort Schafe, die das Gras fressen und schliesslich natürlichen Dünger zurückgeben, und statt Traktoren drei Pferde, die helfen, die schwerere Arbeit zu erledigen. Alles gut, könnte man denken, doch das Problem beim Champagner ist ja eben doch die vorgeschriebene Méthode Traditionelle, die dem Wein durchaus Charakter mitgibt. Oft jahrelange Hefelager gelten als besonderes Merkmal hochwertiger Champagner. Für Alexandre Chartogne sind sie das nicht, er versucht bei jedem Schritt der Weinproduktion den Merkmalen der Herkunft Raum zu lassen. „Beim Genuss von Champagner geht es vor allem um die Textur“, erklärt er. „Die Frucht der Traubensorte oder übertriebene Reifenoten suche ich nicht. Meine Weine sind nicht hier, um Euch glücklich zu machen, sie sind einzig dafür da, Euch den Ausdruck einer Lage zu zeigen.“ Und so ist die Weinbereitung bei Chartogne-Taillet eigentlich nicht der Rede wert. Alexandre arbeitet mit Holzfässern, wie es schon seine Vorfahren getan haben, und ist sehr zurückhaltend mit der Zugabe von Zusätzen wie Schwefel. „Wir Franzosen sind zu faul, um etwas zu machen, das nicht unbedingt nötig ist“, sagt er abschliessend und fragt ganz scheu, ob jemand im Publikum denn noch eine Frage habe, ansonsten würden wir jetzt trinken. Wir trinken und reden und beobachten die Entwicklung von Alexandres Lagenchampagnern im Glas. Der Les Barres Extra Brut 2011 aus der Sorte Pinot Meunier und gewachsen auf Kalk mit Sandauflage hat es uns besonders angetan. Ein komplexer Wein mit vielen Facetten, der einige Zeit im Glas braucht, um sich in seiner vollen Pracht zu zeigen. Ein Apérowein wie so viele andere Champagner ist er ganz sicher nicht, macht aber dennoch vor, während und auch nach dem Essen noch Spass. Womit wir dann wieder am Anfang wären: Alexandre Chartognes Weine sind Champagner, wie sie sein sollen – sie gehen immer.